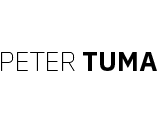Von der Linie zur Farbe
Michael Stoeber, 1999
In der Renaissance gab es einen berühmt gewordenen Streit zwischen den Kunstschulen von Florenz und Venedig. Es ging darum, was den Vorrang haben sollte bei der Wirklichkeitswiedergabe durch die Malerei, die Linie oder die Farbe. Die Florentiner plädierten für die Linie, disegno, die Venetianer für die Farbe, colore. Das war weit mehr als nur ein akademischer Disput. Dabei ging es auch um den Primat von Kopf und Körper, Denken und Empfinden. Wer die Welt im Glanz der Farbe sieht, sieht sie durch das Prisma des Gefühls. Wer sie mit Hilfe der Linie untersucht, erforscht sie eher mit den Mitteln des Verstandes. Überblickt man das Werk von Peter Tuma, fällt auf, dass der Künstler sich von der Linie hin zur Farbe bewegt. Aber auch wenn die Farbe sich in seinen Bildern verstärkt durchsetzt, wird bei ihm daraus noch lange kein Plädoyer gegen den kontrollierenden Verstand. Tuma war schon immer ein nachdenklicher, ein analysierender und fragender Maler, und er ist es bis heute geblieben. Auch als Protagonist der colore gehört er nicht zu denen, die in der Farbe wüten und sich brachial in ihr austoben, sondern er setzt sie präzise und reflektiert ins Bild. Nur ist der kalkulierende Geometer von Form und Linie mit der Zeit immer mehr zum Maler expressiver valeurs geworden mit einem ausgesprochenen esprit pascalien. Peter Tuma hat im Laufe seines Lebens gelernt, stärker auf seine Emotionen zu hören und ihnen zu vertrauen. Mit dem französischen Philosophen Pascal hat er für sich und seine Malerei das weite Land des Gefühls entdeckt. »Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas.« Das Ergebnis für sein Werk sind allerdings keine informellen Seelenstenogramme, sondern Tumas malerischen Referenzpunkte liegen immer noch ganz klar in der ihn umgebenden Wirklichkeit. Aber da der Künstler heute emotionaler malt als früher, sind seine Bilder schwerer zu lesen. Die Farbe macht sie rätselhafter und vieldeutiger in Gestus und Ausdruck. Frühe Bilder sind eindeutig durch die Linie bestimmt, einer geradezu konstruktiv agierenden Linie. Sie befassen sich mit Gewächshäusern, Theaterbauten, Stauwerken und Schiffskörpern. Das tertium com-parationisist stets das architektonische Element. Die Sitzreihen antiker Theater bilden Fächer, die sich auch in der Konstruktion von Staudämmen und Schiffen wiederfinden. Die Fächer von Tumas mächtigem Dionysos Theater oder seinem Stauwerk aus dem Jahre 1981 falten sich auf zu großen Flügeln, die das Thema des Fliegens in den zehn Jahre später erscheinenden Ikarus-Bildern vorwegnehmen. Bauen, Flügel und Freiheit formieren sich zu einer nur scheinbar paradoxen Trias.
Martin Heidegger hat darauf hingewiesen, dass im Althochdeutschen die Verben sein und bauen auf denselben Wortstamm zurückgehen. Der Mensch ist erst da Mensch, wo er sich anbaut. Und er baut sich an, wo er sein kann. Oder er flieht und fliegt zu neuen Ufern wie Dädalus und Ikarus. In Tumas Flugbildern wächst das Flügelmotiv bereits eindeutig aus der Farbe. In Versuch es wieder, Ikarus (1989/90) sind es Gelb, Braun, Siena, Schwarz, Weiß und Grau, aus denen sich das ebenso bizarre wie polyseme Flügelpaar aufbaut, das sich im lähmenden Grau eines weiten, leeren Luftraums zu bewähren sucht. Der Mythos liefert die Metapher für eine sehr malerische, sehr moderne und existentiell anmutende Selbstbehauptungschiffre. Der ins Bild geschriebene, sich um den Flügel schmiegende Titel akzentuiert unpathetisch die Parteinahme für die Wege der Freiheit (Jean-Paul Sartre). Es ist nicht so, dass Tuma auf seinem Weg zur Farbe die Linie grundsätzlich aufgäbe. Aber ihr Status wird ein anderer, sie wird widersprüchlich und vielgestaltig. Die Linie löst sich auf in der Farbe oder behauptet sich in ihr; sie findet ihren Weg ins Zentrum des Bildes oder verliert sich im Abseits der Komposition; sie sucht tastend ihren Weg hin zu einer Figuration, die sie konturiert und zugleich wieder flieht; sie zentriert und fixiert ihren Gegenstand, gibt ihn auf und verlässt ihn; in ebenso fiebriger wie fester Manier sorgt sie für seine polymorphe Anmutung. Sie findet wie die Architekturbilder der achtziger Jahre noch immer ihren Referenzpunkt in der Wirklichkeit, aber deren Beherrschbarkeit scheint unsicher geworden. Verweist das konstruktive Prinzip früher Arbeiten auf das Ingenium des menschlichen Verstandes, spricht die ebenso heroische wie lakonische Apostrophe des Ikarusbildes in eindringlicher Weise vom Scheitern des Menschen und damit auch von seiner Erlösungsbedürftigkeit, diskretes Thema in vielen nachfolgenden Bildern des Künstlers. So erstaunt es nicht, daß in der Folge das Fragment als bildnerisches Motiv breiten Raum im Schaffen Peter Tumas einnimmt. Dabei steht vor allem der menschliche Kopf als Thema im Mittelpunkt der Bilder. Es handelt sich keineswegs um den Kopf als ausdrucksstarkes Porträt eines singulären Individuums, sondern um den Kopf, der seinen Körper verloren hat, der von ihm getrennt wurde, um den isolierten Kopf, der als Zeichen menschlicher Beschädigung und Verletzung ins Bild tritt, als Symbol einer fragmentierten Existenz. Zitiert Tuma die abgeschlagenen Köpfe aus den biblischen Erzählungen von Salome und Johannes, Judith und Holofernes, sorgt er für eine zusätzliche Determinierung seines Motivs. Macht er ihn zum Mittelpunkt seiner Reliquienbilder, verweist er auf den privilegierten Status, den der Kopf als Zentrum des Denkens auch in der religiösen Vorstellung der Menschen einnimmt. Ein Denken, das sich zum Glauben bekennt. Credo quia absurdum. Tumas fragmentierter Kopf ist mehrfach kodiert. Nicht zuletzt ist er ein eindringliches Zeichen dafür, dass uns das Ganze abhanden gekommen ist. Uns selbst kontrollieren wir oft genug ebenso wenig wie die Welt. Allerdings, die Sehnsucht nach dem Ganzen und nach dem Sinn des Ganzen ist immer da. Sie inkarniert sich in der Religion wie in deren Substituten. In naiven Formen der Gläubigkeit, in Reliquienverehrung und Votivgaben, findet diese Sehnsucht einen bewegenden Ausdruck. Nicht umsonst fühlt Tuma sich davon angerührt wie von der schlichten Innigkeit rumänischer und italienischer Volkskunst. Hier dreht sich das Motiv der Fragmentierung dialektisch um. Das Teil wird als Symptom eines unzerstörbaren Ganzen gedeutet und verstanden. Das Fragment ist also ebenso defizient wie sinnhaft. In dieser Rolle begegnet es uns auch in der Kunstgeschichte. So taucht hinter Tumas kritischem und pessimistischen Blick auf die conditio humana der Moderne zugleich der Traum eines verloren Paradieses auf. Der Verlust wird dadurch, wie es nicht anders sein kann, nur noch schärfer empfunden.
In den letzten Jahren hat es im Werk von Peter Tuma einen Blickwechsel gegeben. Die Farbe spielt wie zuvor ihre emotionalisierende Rolle bei der Verfertigung des Bildes. Das Fragment ist immer noch da als bestimmendes Sujet. Kopf, Körper und Herz sind weiterhin wichtige Themen des Bildes wie auch des Künstlers ambivalente Vorstellung von der Reliquie. Aber all diese Motive rücken in einen neuen Bedeutungszusammenhang. Peter Tuma hat in der modernen Massenbegeisterung für den Fußball so etwas wie eine Ersatzreligion ausgemacht in gottfernen Zeiten. Und wie die Preußen nicht nur gute Christen, sondern stets auch gute Soldaten waren, gewinnt die Begeisterung der Menschen für den Fußball ebenso religiöse wie kriegerische Züge. Das militante Moment des Spiels manifestiert sich im Grunde schon in der fußballerischen Terminologie, Schuss, Angriff und Verteidigung, sodann im marodierenden Vandalismus so mancher Fans und schließlich in den Namen der Vereine, beispielsweise Borussia, Alemannia, Fortuna, die sich herleiten von den schlagenden Verbindungen der Burschenschaften. Die Vereinsnamen ziehen bei Tuma als Wort- und Schriftbild mit ins Werk. Soziologen haben oft genug auf die Funktion des Ersatzkrieges hingewiesen, die ihrer Meinung nach die Spiele auf dem grünen Rasen haben, auf den Aggressionsabbau und die Katharsis solcher Begegnungen für das Publikum. Dass der Fußball auch so etwas wie eine Ersatzreligion geworden ist, dass die Spielerstars durch ihre Fangemeinde nicht selten in den Rang von Heilsbringern erhoben werden und der Gewinn eines Pokals sich darstellt wie die Erlangung der Seligkeit ist weniger oft gesagt worden. In Tumas Bildern zum Thema steht dieser Aspekt im Mittelpunkt. In der Optik des fanatisierten Blicks lässt sich die Begegnung zweier Mannschaften auch lesen als Kampf des Guten gegen das Böse. Der Sieg der eigenen Mannschaft ist stets ein Stellvertretersieg. Wie im Leben bleibt bis zum Ende alles offen. Ein Torschuss in letzter Minute bedeutet eine Art Epiphanie, durch die man zum Heil gelangt. Und weil es Regeln gibt, ist der Weg zur Seligkeit auch überschaubar. Trotz aller möglichen Überraschungen herrscht im Spiel eine Gerechtigkeit, die das Leben oft schmerzlich vermissen lässt. Darin beruht die wahre Moral des Fußballs und seine eigentlich kathartische Wirkung.
Die Referenzen zur Religion in Peter Tumas Bildern sind vielfältig. Die Trikots der Spieler sehen aus wie die Hemden von Heiligen und die Gewänder von Märtyrern. Die Pokale als leuchtende Trophäen des Sieges gewinnen den Status geweihter Kelche, aus denen der Gläubige das Blut Christi trinkt. Die Bilanzen der Spiele formieren sich zur kryptischen Liste, die Ähnlichkeit aufweist mit der Heiligen Schrift. Quod dixi, dixi; quod scripsi, scripsi. Die Spielergebnisse erscheinen so sakrosankt wie die geoffenbarten Wahrheiten der Religion. Die Versammlung von Fußballerbeinen und -armen rückt Tuma ganz bewusst in die Nachbarschaft zu seinen Reliquienschreinen. Die Titel der Bilder verdeutlichen die Sakralisierung des Fußball: Reliquienwand/Fortuna 08 heißt es da oder Heldenreliquie oder Die Ausschüttung des Heiligen Geistes über dem BVB oder Kanopen und Sportlerherzen. Kanopen kennen wir aus dem altägyptischen Grabkult. In der Vorstellung der Ägypter hörte das Leben mit dem Tode keineswegs auf, sondern ging weiter in »jenem Land, aus dem kein Wanderer wiederkehrt« (Hamlet). Dies allerdings galt es unbedingt unversehrt zu erreichen. So erklärt sich der sorgfältige Kult der Mumifizierung und die Sonderbestattung der Eingeweide in große Urnen, den Kanopen. Tuma malt diese Kanopen als schwere, schwarze Gefäße. Sie stehen exponiert vor einem Raster aus verwaschen Farbquadraten, das wirkt wie die blasse Bühne eines verwalteten Alltags, auf der sie einen fulminanten Auftritt haben. Den Kanopen strecken die Sportlerherzen ihre Blutgefäße wie zitterige, weiße Finger entgegen, als wollten auch sie für die Ewigkeit aufbewahrt und nicht schon in der übernächsten Saison wieder vergessen sein.
In Derek Jarmans Buch der Farben Chroma lesen wir: »Schwarz-Gelb signalisiert eine Warnung: Achtung, ich bin eine Wespe - Abstand halten!« Wahrscheinlich ist es diese aggressive, diese eigentlich »unmögliche« (Tuma) Farbverbindung, die den Künstler bewogen hat, bei seinen emblematischen Fußballdarstellungen immer wieder auf die Borussia Dortmund zurückzukommen. Schwarze Hosen und gelbes Trikot kennzeichnen ihre Spieler. Ein Gelb so beißend wie Senf und ein Schwarz so dunkel wie die Kutte eines Priesters. In Tumas Bild Große Embleme/BVB spannt sich ein schwarzes, ovales Rund vom linken zum rechten Bildrand in einer schwefelgelben Farbsee. Das Oval sieht aus wie ein riesiger Pokal, wie eine gefährliche Arena oder eine aggressive Sprechblase, aus der als finsteres Fanal die beiden Anfangsbuchstaben des BVB auftauchen. Bei van Gogh meint man förmlich das unheilvolle Krächzen seiner schwarzen Krähen zu hören, wenn sie sich durch das gelbe Korn in den düsteren Himmel schrauben. In Tumas Werk glaubt man einen gigantischen schwarzen Massenschlund sich öffnen zu sehen zum bedrohlichen Fanschrei. Immer wieder erscheinen in Peter Tumas Bildern die Trikots der Spieler als Motiv der Heldenverehrung. In ähnlicher Funktion begegnet uns das Hemd in seinem Œuvre bereits 1973 als Protest-Ikone gegen die Ermordung des vom Volk gewählten Präsidenten Salvatore Allende und gegen die gewaltsame Übernahme des demokratischen Chile durch das Militär. Den malerischen Weg, den Tuma in fünfundzwanzig Jahren zurückgelegt hat, ermißt man am besten, wenn man das Chemise chilienne mit dem Hemd des Triumphators aus dem Jahre 1998 vergleicht. Dort sehen wir in fast fotorealistischer Manier das präzise Abbild eines blutbefleckten Hemdes vor schwarzem Hintergrund, hier die affektiv aufgeladene Konfrontation eines aggressiven Gelb-Rot Gegensatzes, das erhitzte Mit- und Gegeneinander von Bildgrund und Bildfigur. Auch in dem Bild aus dem Jahre 1998 nimmt man das Trikot als Hemd wahr, obwohl es sich dabei genauso gut um einen abstrahierten Torso handeln könnte. Gerade die Uneindeutigkeit und Mehrdeutigkeit des durch die Farbe gehaltenen Motivs nehmen den Betrachter für das Hemd des Triumphator sein. Sie stärken seine assoziative Freiheit gegenüber dem Bild, das in der Identifizierung von Kleid und Person der psycho-historischen Logik der Heldenverehrung folgt. Außerdem intensiviert das Emblem des Kreuzes auf dem Trikot die quasi religiöse Anmutung des Motivs. Das Bild ist Universalie menschlicher Kampf- und Leidensbereitschaft, befreit von den konkreten Umständen eines bestimmten Ortes und einer bestimmten Zeit. Aber vor allem ist es erst einmal und zuallererst ein Bild. »Alles andere ist alles andere« (Ad Reinhardt), auch das, was wir hier an theoretischem Überbau zur Ikonologie bei Tuma ausbreiten. Ein Bild, das uns auf Grund seiner elementaren Farbgewalt bewegt, das unsere Sinne berührt, bevor es unseren Geist beschäftigt. Ein Bild, dessen Farbverläufen wir zugleich lustvoll und ängstlich hinterhersehen, dessen heftigen Pinselgestus wir nachempfinden und unter dessen schrillem Sirenengesang wir zusammenzucken.
In diesem Sinne gibt der Aphorismus von Friedrich Nietzsche, den wir als Motto diesen Ausführungen vorangestellt haben, den Tenor vor. Auf die Mittel des Malers kommt es an, auf das, was der Künstler mit Leinwand, Pinsel und Farbe macht, nicht auf das, was er damit machen möchte. Seine Intentionen, Überzeugungen und Ideale zählen nur, insoweit sie sich in der Form, im Gestus, im Bild materialisieren. Da müssen sie ihren Ausdruck finden. Genau das passiert in den Arbeiten von Peter Tuma. Nicht dass er sich mit dem anspruchsvollen Thema des Numinosen im Alltag befasst, macht seine Bilder kostbar, bewegend und überzeugend. Kostbar werden sie, weil der Künstler uns durch die ihm zur Verfügung stehenden, malerischen Mittel bewegt und überzeugt.
Michael Stoeber, Von der Linie zur Farbe. Zu den neuen Arbeiten von Peter Tuma, in: Peter Tuma. Neue Bilder, Kornspeicher der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Wolfenbüttel 1999, o. S.